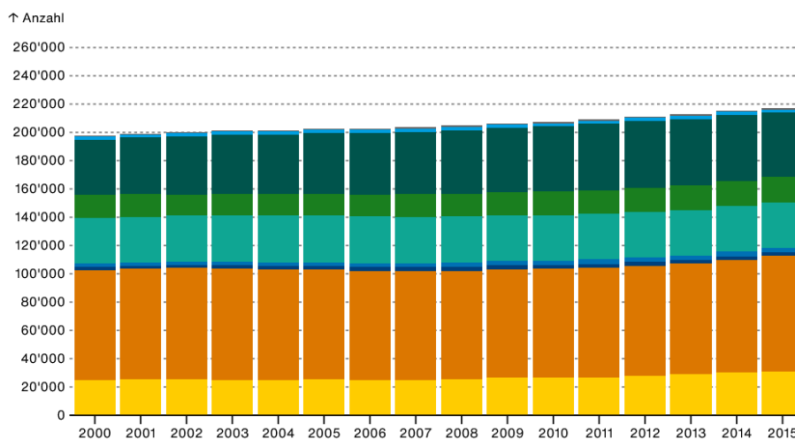Gewaltprävention und -intervention an Schulen
An den Schulen ist Gewalt ein immer gegenwärtiges Thema. Die Schulverantwortlichen sind sich dessen bewusst. Insgesamt werden Gewaltvorfälle in der Volksschule häufiger beobachtet als auf der Sekundarstufe II.
Auf dieser Seite
Einleitung
Gewalt an Schulen kann sich auf unterschiedliche Arten und Weisen äussern. Es gibt physische, verbale, psychische oder sexuelle Gewalt sowie Gewalt gegen Sachen oder sich selbst gerichtete Gewalt. Hinzu kommen Formen wie das Cybermobbing oder Gewalt im familiären Umfeld, die in die Schule hineinwirken. In der Volksschule wird am häufigsten von psychischer Gewalt gegen Schülerinnen und Schüler berichtet, gefolgt von physischer Gewalt, Vandalismus sowie Mobbing / Cybermobbing. Auf der Sekundarstufe II rangiert ebenfalls die psychische Gewalt am höchsten. Physische Gewaltvorkommnisse treten eher in den Hintergrund, dafür beobachten schulische Mitarbeitende vermehrt selbstverletzendes Verhalten, Mobbing / Cybermobbing sowie Vandalismus.
Die Schulverantwortlichen sind sich der Problematik bewusst. Verschiedene Anlaufstellen unterstützen Schulen bei der Gewaltprävention und -intervention.
Die Analyse untersucht die verschiedenen Gewaltformen, mit denen Schulen konfrontiert sind, und deren Bewältigungsstrategien. Ziel ist es, die Unterstützungsangebote des Kantons Zürich an den Bedarf der Schulen anzupassen und aufzuzeigen, welche Gewaltformen noch unzureichend adressiert werden.
Durchgeführt wurde sie von der Pädagogischen Hochschule Zürich und der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW um Auftrag der Bildungsdirektion des Kantons Zürich.
Methodische Details
Datengrundlage
Literatur- und Dokumentenanalyse, Experteninterviews, teil-standardisierte Befragung von Lehr- und Fachpersonen an Volksschulen und Schulen der Sekundarstufe II im Kanton Zürich (6. Januar bis 28. Februar und 17. bis 28. Mai 2021)
Methodik
Der Bericht basiert auf einer Literatur- und Dokumentenanalyse, Experteninterviews und eine Befragung von Lehr- und Fachpersonen.
In der Literaturanalyse wurden die internationale Forschungsliteratur sowie die Erkenntnisse aus bereits existierenden Forschungsprojekten aus der Schweiz bezüglich Zielsetzungen und Fragestellungen gesichtet und aufbereitet. Zur inhaltlichen Konkretisierung der Fragestellungen und der Vorbereitung der Befragung wurden 13 Interviews mit Lehr- und Fachpersonen geführt. Die eigentliche Befragung in Form eines Online-Fragebogens bezog sich primär auf die Frage, mit welchen Formen von Gewalt die Schulen konfrontiert sind. Dazu wurde ein Katalog von zehn Gewaltarten erstellt.
Insgesamt haben sich 1256 Personen bereit erklärt, die Fragen der Bedarfsabklärung zu beantworten. Die quantitativen Auswertungen der Daten aus der Befragung umfassen Häufigkeitsverteilungen und Kreuztabellen. Die im Bericht verwendeten Skalen sind mit Reliabilitätsanalysen auf ihre interne Konsistenz getestet. Als Mass für die interne Konsistenz kommt Cronbach’s Alpha verwendet. Die bivariaten Zusammenhänge sind mittels Pearson Korrelationskoeffizient (r) berechnet. Die Typenbildung zum Gewaltverständnis der Schulleitungen und Lehrpersonen erfolgt anhand von Clusteranalysen (binäre Distanzmatrix, Clustering nach Ward). Die qualitativen Auswertungen der Daten erfolgt mit einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015). Die Kodierung entsteht dabei zuerst deduktiv, entlang der Fragestellungen, und in einem zweiten Schritt induktiv, um nicht vorgegebene, in den Antworten der Studienteilnehmenden enthaltene Themen zu berücksichtigen. Die Aussagen sind teilweise nach Altersgruppen (unter 29-Jährige, 30- bis 39-Jährige, 40- bis 49-Jährige, 50- bis 59-Jährige und über 60-Jährige) geordnet. Die Nennungen im Zusammenhang mit dem Pandemiegeschehen sind mittels zweier separater Fragen gestellt und ausgewertet.
Impressum
publiziert im Januar 2022
Herausgeberin/Auftraggeberin
Bildungsdirektion Kanton Zürich, Bildungsplanung
Redaktion
Mirjam Nievergelt
Roger Keller
Reto Luder
Carlo Fabian
André Kunz
Pädagogische Hochschule Zürich, Zentrum Inklusion und Gesundheit in der Schule
Hochschule für Soziale Arbeit FHNW, Institut für Soziale Arbeit und Gesundheit
Bitte geben Sie uns Feedback
Ist diese Seite verständlich?
Vielen Dank für Ihr Feedback!
Kontakt
Bildungsplanung