Mitten in Zürich steht ein riesiges neues Gebäude – das Polizei- und Justizzentrum. Ein Teil davon ist das Gefängnis Zürich West. Zusammen mit rund 170 anderen Freiwilligen hat der Zürcher Schriftsteller Thomas Meyer eine Nacht dort verbracht.
Auf dieser Seite
Vorläufige Festnahme – ein Text von Thomas Meyer
Das hier ist nicht echt. Ich weiss das. Ich weiss, dass ich nichts verbrochen habe und nur ins Gefängnis gehe, um darüber zu schreiben. Und auch nur für eine Nacht. Ich weiss, dass ich morgen früh in mein Leben zurückkehren werde. Aber kaum sitze ich im VW-Transporter der Kantonspolizei, der mich innerhalb weniger Minuten von der Kaserne zum neuen Gefängnis Zürich West bringt, beschleicht mich das verstörende Gefühl, nicht mehr zu den Menschen zu gehören, die auf den Trottoirs der Militärstrasse herumlaufen. Eine Empfindung, die sich in den kommenden Stunden erheblich steigern wird.
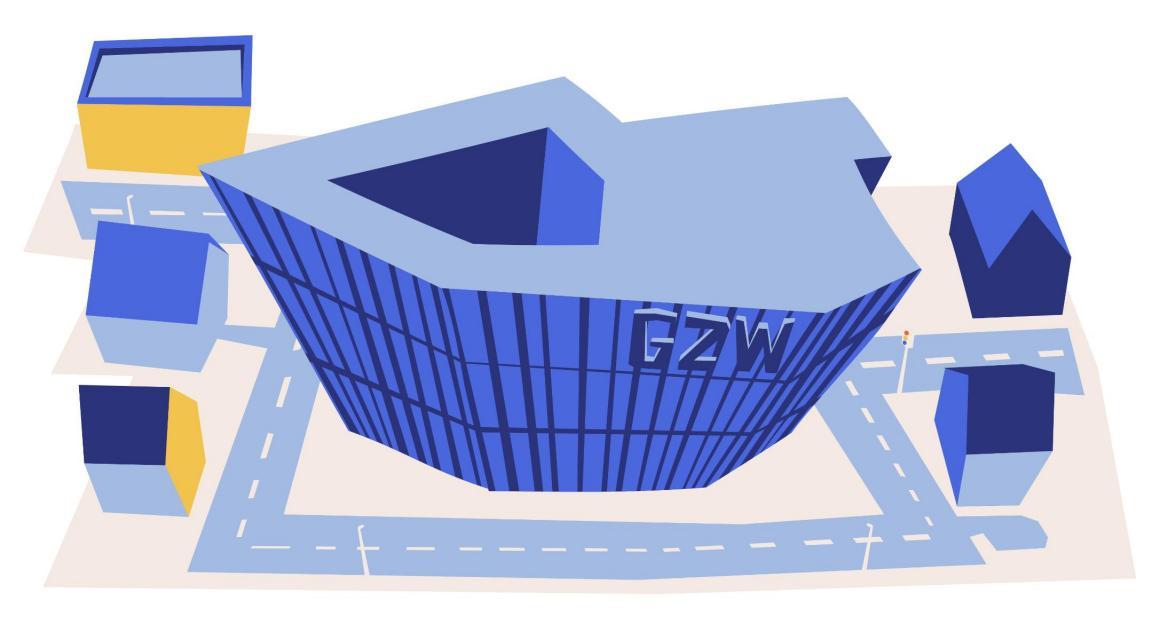
Nach dem Aussteigen werden mir Handschellen angelegt. Zwar nur, weil ich das entsprechende Angebot des freundlichen Beamten annehme, aber dennoch, es ist ein echter Beamter, und es sind echte Handschellen. Und es ist eine echte Wartezelle, in der ich mich kurz darauf wiederfinde, für zehn Minuten, wie man mir mitteilt, bevor die schwere Tür ins – auf meiner Seite klinkenlose – Schloss fällt. Der Raum ist vier mal vier Meter gross, ebenso hoch und enthält eine Tischplatte aus Beton und eine vandalensichere Chromstahl-Toilette. Aus den zehn Minuten werden zwanzig, dann dreissig – schätze ich, ich trage heute keine Uhr, und mein Handy liegt längst irgendwo zusammen mit meinem Schlüsselbund in einem Plastikbeutel. Ich frage mich, ob man mich womöglich vergessen hat. Ob ich die Nacht hier verbringen muss. Ob ich hungers sterben werde, keine zehn Velominuten von meinem vollen Kühlschrank zu Hause entfernt. Das sind keine vernünftigen Überlegungen, aber sie drängen sich immer mehr auf, denn mittlerweile ist bestimmt mehr als eine Dreiviertelstunde vergangen, in der ich nichts anderes getan habe, als die weisse Wand anzugucken, auf der ich bereits Muster zu erkennen glaube, und mich zu fragen, wie es meinem Sohn gehe. Der arme kleine Kerl hat Long Covid und ist seit Wochen zu nicht viel mehr fähig, als auf dem Sofa zu liegen und Minecraft-Videos auf YouTube zu gucken, kann sich aber, weil er so erledigt ist, gar nicht richtig drüber freuen.
Sitze ich schon eine Stunde hier? Zwei? Ich kann es nicht mehr sagen. Manchmal höre ich ferne maschinelle und menschliche Geräusche, dann lange keine mehr. Ich bin überzeugt, dass die Beamtinnen und Beamten alle nach Hause gegangen sind und ich definitiv hier drin übernachten muss. Schliesslich öffnet sich das Sichtfenster in der Tür, und jemand guckt herein. Vermutlich, um zu prüfen, ob ich gerade auf dem Klo sitze. Dem ist nicht so, und die Tür geht ganz auf. Endlich komme ich hier raus. Ich hatte begonnen, mich dem Wahnsinn ein interessantes Stück näher zu fühlen.

Für die Übernachtung bin ich bestens vorbereitet: Pyjama, frische Unterwäsche, ein Pulli, Necessaire, ein neues Buch, der aktuelle SPIEGEL. Das war naiv, ich hätte überhaupt nichts mitzubringen brauchen, weil ich nun alles abgeben muss, mitsamt der Kleidung, die ich am Leib trage und die samt und sonders gegen Gefängniskleidung ausgetauscht wird: weisses Unterhemd, schwarze Unterhose, schwarze Trainerhosen, graues Sweatshirt, schwarze Socken, schwarze Pantoffeln, Grösse 42, mehr ist noch nicht vorrätig, ich habe 44, sagen meine Zehen.
Ein weiterer freundlicher Herr – hier sind alle sehr nett, und ich bin überzeugt, dass das später gegenüber der echten Kundschaft beibehalten wird, abgesehen natürlich von Sätzen wie: »Einen angenehmen Aufenthalt« und »Viel Vergnügen« – führt mich in meine sogenannte Wohnzelle, die Zelle F130. Ich staune nicht schlecht: Der Raum ist gross wie ein Hotelzimmer und hat einen Parkettboden. Auch der Startbildschirm des Fernsehers ist wie im Hotel gestaltet; mit dem Logo des Kantons Zürich und zwei hübschen Fotos, eines von der Stadt mit dem Prime Tower in der Mitte und eines vom Innenhof des Gefängnisses. Daneben ist der Tagesablauf aufgelistet: 6.45 Weckruf, 7.15 Frühstück, 8.30 Bücher und Zigaretten, 10.00 Duschen etc.
In diesem Zimmer werden Menschen leben, die vorläufig festgenommen worden sind, für maximal 96 Stunden. Danach kommen sie entweder wieder auf freien Fuss, weil ihr Delikt geringfügig war oder sie sich als unschuldig erwiesen haben, oder ein Stockwerk weiter oben in Untersuchungshaft, was dann wesentlich länger dauern kann. Kontakt zur Aussenwelt ist nur möglich via Briefpost; in einer kleinen Plastikbox liegen nebst dem dafür nötigen Papier mit Umschlägen eine Zahnbürste, Essbesteck, Trinkbecher, Taschentücher und ein Stücklein Seife. Ich verfasse einen Brief an meinen Sohn («Hallo! Papa schreibt Dir aus dem Gefängnis!») sowie einen an meine Partnerin. Ich hatte vor Tagen beiläufig erwähnt, dass ich bald eine Nacht hier verbringen würde, habe es aber erst heute Nachmittag konkret angemeldet: «Hallo! Ich gehe jetzt ins Gefängnis!» Meine Freundin war so verdattert, als wäre es echt, als würden wir richtig getrennt. Und auch wenn morgen alles wieder beim Alten sein wird, fühlt es sich hier, am Tisch im Zimmer F130, in der überraschend bequemen schwarzgrauen Kluft, genau so an. Es ist angesichts meiner kümmerlichen kriminellen Energie zwar nicht notwendig, aber ich beschliesse dennoch, niemals straffällig zu werden. Mit dem Freiheitsentzug könnte ich vielleicht irgendwann leben, ich bin ohnehin am liebsten zu Hause, und so viel weniger luxuriös als dort ist es hier nicht. Aber meinen Liebsten nicht nahe zu sein, das fände ich unerträglich.

Dass ich mich ausserhalb meiner eigenen Wohnung nirgendwo mehr so richtig wohl fühle, ist eine Begleiterscheinung fortgeschrittenen Alters und ein weiterer Grund, sich nichts zuschulden kommen zu lassen. Ich werde hier nicht gut schlafen, das weiss ich schon jetzt: Das Kissen ist mir zu hoch, das Bett zu schmal, die Decke zu dünn, und das Fenster lässt sich nicht öffnen. Irgendwoher wird ständig frische, aber trockene Luft zugeführt. Schon schwillt meine Nase zu, und meine Lippen werden spröde. Ich bitte den Gesundheitsdienst, mir den Nasenspray und die Pomade aus meinem Gepäck zu bringen. Es dauert etwas, aber schliesslich wird die Durchreiche in der Tür aufgeklappt, und ich empfange die beiden erlösenden Objekte mit einem geradezu familiären Gutenachtwunsch.
Exakt um 6.45 erklingt der Weckruf via Gegensprechanlage. Ein Beamter wünscht gutgelaunt einen guten Morgen. Mich zieht es heftig in die Freiheit. Das einzige, was ich von ihr sehen kann, ist das kleine hellblaue Himmelsquadrat über dem Innenhof, was ich als zuschnürend empfinde. Ich will den ganzen Himmel sehen, ich will mich frei bewegen können, ich will zu meinem Sohn und zu meiner Partnerin. Nach einer Nacht im Gefängnis ist es mir ein absolutes Rätsel, wie jemand sich so verhalten kann, dass auch nur das geringste Risiko besteht, hier drin zu landen. Aber vermutlich haben sich alle Straffälligen für kriminelle Genies gehalten, zehnmal schlauer als die Polizei, unmöglich zu fassen.
Auf Netflix habe ich mal eine Serie entdeckt, «Die schlimmsten Gefängnisse der Welt» oder sowas, ich fand den Trailer schon so ekelhaft, dass ich es mir nicht angesehen habe. Aber eine Schweizer Haftanstalt wird in dieser Serie gewiss nicht vorkommen, und das neue Gefängnis Zürich West schon gar nicht. Nicht bei dem Ausbaustandard, nicht bei dem Personal. Es ist nicht skandalserientauglich. Eher noch würde es als Satire durchgehen.
Um 8 Uhr werde ich entlassen. Ich bekomme meine Sachen zurück, quittiere den Empfang, mit einem Summen geht die Tür auf, und ich bin frei. Die Sonne scheint. Das 8er-Tram kommt. Am Hardplatz steige ich um, der 33er lässt auch nicht lange auf sich warten. Ich kann gehen, wohin ich will – und habe mich auch schon bereits wieder daran gewöhnt. So schnell, wie die Häftlingsrealität mich durchdrungen hat, so leicht werde ich sie wieder los. Das kenne ich aus dem Militär, wo wir, kaum hatten wir am ersten WK-Tag die Uniform angezogen, nicht mehr «zu Hause» sagten, sondern «im Zivilen».
Nun, da ich weiss, wie es ist, für eine Nacht seiner Freiheit beraubt zu sein, habe ich eine Vorstellung davon, wie es sich anfühlen muss, jahrelang hinter Gittern zu sitzen. Wie also muss es jenen gehen, die das unschuldig tun – und dabei sogar auf ihre Hinrichtung warten? Oder Menschen in Russland, denen 15 Jahre Haft drohen, wenn sie den Krieg in der Ukraine als Krieg bezeichnen? Und was stimmt nicht mit den Schweizerinnen und Schweizern, die ihr Land als Diktatur bezeichnen?
Das sind meine Gedanken, während ich nach knapp zehn Minuten aus dem Bus aussteige, als freier Mensch in einem freien Land, das in seinen Gefängnissen Parkett verlegt. Weil es die Menschen, die dort leben, eben als Menschen betrachtet.
Weiterführende Informationen
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.